 Lahmer, tiefer, kürzer?
Lahmer, tiefer, kürzer?
von Andreas Platthaus
Legende allein genügt nicht: Die Comicbiographie über den tschechischen Wunderläufer Emil Zátopek hat ein paar Schwächen zu viel
In meiner Kindheit gab es im Gästezimmer einer Großtante, bei der ich manches Wochenende verbringen durfte, ein Buch, an dessen Titel ich mich nicht erinnere, das aber großen Persönlichkeiten des Sports gewidmet war: unter anderen Toni Sailer, Jochen Rindt, Armin Harry, Max Schmeling, Cassius Clay (damals war Muhammad Ali als sein Name noch nicht fest etabliert) und auch Emil Zátopek, der tschechischen Lokomotive. Ich würde vermuten, dass mindestens die Hälfte dieser Namen heute nicht mehr Allgemeingut sind.
Ganz sicher weiß ich es bei Zátopek, denn sonst gäbe es wohl kaum ein von der tschechischen Regierung gefördertes Projekt „Zátopek 2016“ (warum just dieses Jahr, ist vollkommen unersichtlich; der Sportler wurde 1922 geboren, starb 2000 und gewann seine olympischen Goldmedaillen 1948 und 1952), „dessen Zweck es ist, an diesen überragenden Läufer zu erinnern, der ein Vorbild für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist“. Im Rahmen von „Zátopek 2016“ wurde auch ein Comic erstellt, der die Geschichte von Emil Zátopek erzählt, geschrieben von Jan Novák, einem vor allem durch seine Drehbücher berühmt gewordenen tschechischen Autor, der jetzt in Amerika lebt, und gezeichnet von Jaromír Svejdík, der unter dem Pseudonym Jaromír 99 sowohl Musik als auch Comics macht. Vor drei Jahren erschien seine Adaption von Kafkas „Schloss“, doch berühmt wurde er durch den von Jaroslaw Rudis geschriebenen Comic „Alois Nebel“.
Der erschien seinerzeit beim Leipziger Verlag Voland & Quist und war ein für Comicverhältnisse schöner Erfolg (vor allem, als noch der gleichnamige Trickfilm dazukam). Deshalb hat der Verlag sich nun auch für die Publikation von „Zátopek“ entschieden, zumal die Übersetzung vom tschechischen Kulturministerium gefördert wurde. Allerdings ganz sicher nicht gelesen. Offenbar von niemandem. Denn man findet im Text so erstaunliche Behauptungen, wie die, dass Zátopek als Läufer Rekordzeiten überboten hätte. Das kann ich auch, jederzeit sogar, denn was wäre einfacher, als über einem Laufrekord zu bleiben? Dafür hat Zátopeks Ehefrau Dana, eine Speerwerferin, im Comic den Landesrekord unterboten. Auch nicht schwierig bei einer Wurfdisziplin. Wenn schon einmal falsch, dann auch konsequent. Dass an anderer Stelle davon die Rede ist, dass Dana Zátopekova „zwischen zwei Olympiaden“ zahlreiche Rekorde aufgestellt habe, fällt da kaum noch auf. Gemeint ist natürlich der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen, also eine Olympiade.
In einer Sportlercomicbiographie sollte solcher Unsinn nicht stehen, aber es ist im Buch auch vorsorglich gar kein Übersetzer angegeben. Nur die Übersetzungsförderung, und das war wohl auch wichtiger für den Verlag. Fließt einmal Geld, braucht man sich ja sonst keine Gedanken mehr zu machen, Augen zu und durch, wie die tschechische Lokomotive. Wieder ein Beispiel dafür, dass Comicübersetzungen oft mit einer Nachlässigkeit redaktionell betreut werden, die bei Sachbüchern oder Literatur als Skandal empfunden würde. Aber die Bilder kaschieren so viel.
Und für sie lohnt sich die Lektüre von „Zátopek“, vor allem im ersten Teil. Bis Emil Zátopek nämlich endlich richtig ins Laufen kommt, arbeitet er von 1937 bis 1947 bei der tschechischen Schuhfirma Bata. Und wie Jaromír 99 deren Werksgelände ins Bild setzt, das weckt dermaßen viele Assoziationen an die Grafik der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, besonders an Frans Masereel, dass man sich bei jedem Umblättern schon auf die Überraschung der nächsten beiden Seiten freut. Der deutsche Verlag bietet leider keine Leseprobe an, aber für die Bebilderung ist ja auch das tschechische Original aussagekräftig. Dem Sportlerleben, nachdem Zátopek zur Armee ging, kann der Comic dagegen kaum noch originelle Bildideen abgewinnen.
Allerdings hat die Geschichte von Jan Novák auch nichts Reizvolles zu bieten, so dass man schon dankbar ein muss, wie viel Jaromír 99 aus dem Beginn herausgeholt hat. Erzählt wird ohnehin nur bis 1952, den Olympischen Spielen von Helsinki, auf denen Zátopek als bislang einziger Mensch über 5000 Meter, 10.000 Meter und Marathondistanz Gold gewonnen hatte. Nach dem Zieleinlauf des Marathonlaufs noch ein Kuss von Dana, dann ist Schluss. Danach begannen im wahren Leben auc die sportlichen Nackenschläge. So etwas erzählt man weniger gern.
Dafür werden die Widerstände hervorgehoben, die Zátopek in der Tschechoslowakei zu überwinden hatte. Zum Militär ging er der besseren Trainingsmöglichkeiten wegen, nicht aus Überzeugung, schon gar nicht nach der Errichtung der kommunistischen Diktatur im Jahr 1948, obwohl sein Vater überzeugter Kommunist war. Zátopek war Politik egal, er wollte laufen, und wenn er sich für einen ideologisch unzuverlässigen Kameraden einsetzte, dann interessierte ihn dessen Aussicht auf sportlichen Erfolg, nicht die Einstellung für oder gegen den Staat. Dass daraus ein Konflikt erwuchs, der fast zum Verzicht Zátopeks auf seine Starts in Helsinki geführt hätte, wird von Novák zum dramatischen Höhepunkt seiner Erzählung gemacht.
Doch bei einer Figur wie Zátopek, die schon auf dem Titelbild das Zielband als Erster durchreißt, kann durch einen solchen Effekt keine Spannung entstehen. Zu glatt läuft die Karriere des Läufers ab, unbeirrbar erfolgreich wie dessen Wettkämpfe, als dass man jemals mit einem Scheitern rechnete. Dadurch wird der Comic nur interessant für Leser, die etwas über Zátopek erfahren wollen; wenig sportbegeistertem Publikum bietet er nichts – außer den bereits gelobten graphischen Finessen des Auftakts.

 In Erlangen erlangt man traurige Erkenntnis
In Erlangen erlangt man traurige Erkenntnis Die Sondermannpreisträger für das Jahr 2016 stehen fest. Einer festlichen Verleihung am 11.11. in der Frankfurter Brotfabrik steht nun nichts mehr im Wege.
Die Sondermannpreisträger für das Jahr 2016 stehen fest. Einer festlichen Verleihung am 11.11. in der Frankfurter Brotfabrik steht nun nichts mehr im Wege.  Aufgeweckte Altstars
Aufgeweckte Altstars Die Büchse der „Pandora“ sprudelt reichhaltig
Die Büchse der „Pandora“ sprudelt reichhaltig Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.
Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.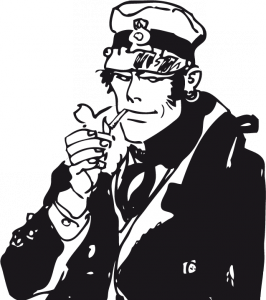 Die Lücke im Cortoversum
Die Lücke im Cortoversum Fakten vs. Pathos
Fakten vs. Pathos Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat
Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat