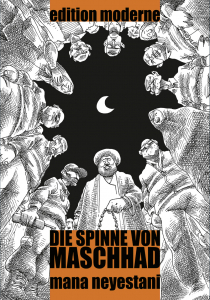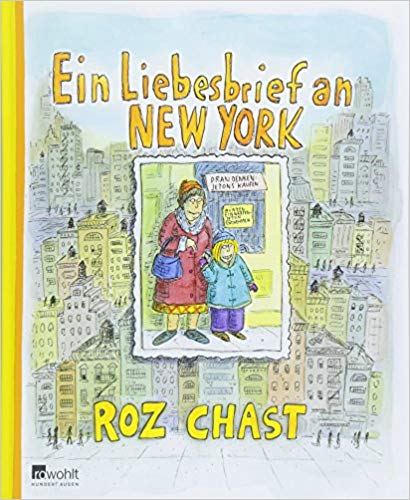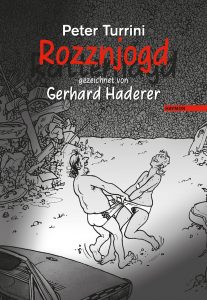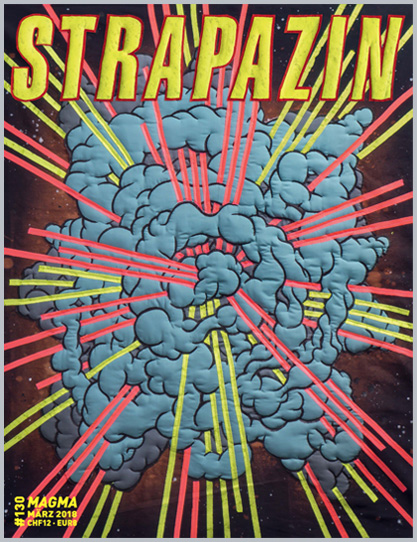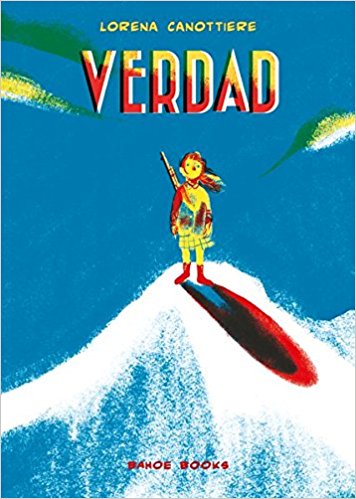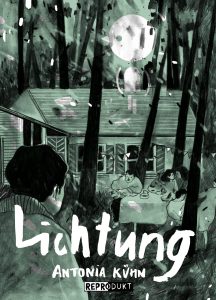Schulmädchenreport der anspruchsvolleren Art
Die in Nigeria geborene Sylvia Ofili und die in mehreren afrikanischen Staaten aufgewachsene Birgit Weyhe haben sich für einen Comic zusammengetan, der auf der Grundlage von Ofilis Erlebnissen von deren Schulzeit in Lagos und dem Studium in Hamburg erzählt. Aber das Ganze bleibt banal.
Birgit Weyhe ist ein deutschen Comicwunder, aber darüber muss man sich nach zehn Jahren nicht mehr wundern. Beginnend mit den autobiographischen Erzählungen in „Ich weiß“ und dann über „Reigen“ und „Im Himmel ist Jahrmarkt“ bis zu ihrem bislang meistgefeierten Band, der Doku-Fiktion „Mad Germanes“, hat die Hamburger Autorin und Zeichnerin einen ganz persönlichen Stil etabliert, der von einem graphischen Detail- und Assoziationsreichtum geprägt wird, in dem Weyhes lange Jugendjahre in Afrika und ihre Kenntnisse von Mythologie und Alltag dort zum Ausdruck kommen. Die mündliche Erzähltradition des afrikanischen Kontinents ist dabei immer wichtiger geworden für das Werk der Deutschen, und in „Mad Germanes“ traten schließlich drei Protagonisten wie Zeugen vor die Leser, um ihre miteinander verwobenen Lebensgeschichten als Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR und nach deren Untergang in der Bundesrepublik zu schildern.
So ist Birgit Weyhe nolens volens auch zur Chronistin der Beziehungen von Afrika und Deutschland geworden – durchs eigene Leben und die Geschichten, die sie publiziert hat. „Mad Germanes“ war dabei ein ungeplantes Zwischenspiel, denn eigentlich hätte dieser Band erst später fertig werden sollen. Die Zuerkennung des Leibinger-Comicbuchpreises für den entstehenden Band forcierte aber dessen Fertigstellung. Zum Glück. Denn zuvor hätte ein schon früher begonnenes Comicprojekt entstehen sollen, bei dem Weyhe nur als Zeichnerin agierte. Grundlage dafür war ein Szenario der aus Nigeria stammenden und heute in Schweden lebenden Autorin Sylvia Ofili über deren Jugend in einem nigerianischen Internat und ihre darauf folgende Übersiedelung nach Europa. Da es Olivia, Ofilis Alter Ego im Buch, zum Studium nach Hamburg verschlägt, schien die dort lebende Birgit Weyhe die ideale Partnerin bei dem Comic-Vorhaben, zumal angesichts ihrer eigenen afrikanischen Vergangenheit. Und das ist daraus geworden.
Aber die Zusammenarbeit zog sich länger hin, als geplant; schließlich waren die Arbeitsrhythmen zweier Autorinnen zu koordinieren, „Mad Germanes“ kam noch dazwischen, und so ist der Band erst jetzt herausgekommen, zwei Jahre später als beabsichtigt. Er trägt den Titel „German Calendar No December“ – ein Zitat aus einer nigerianischen Comedy-Fernsehserie, die zu stehenden Redewendung zwischen der jungen Olivia und ihrem Vater geworden war. Nur versteht vor der Lektüre des Comics kein Leser diese Anspielung, und das ist der erste Fehler des Bandes. Der zweite ist, dass der Avant Verlag nicht darauf bestand, dass man nach Weyhes Erfolg mit „Mad Germanes“ einen anderen Titel für ihren Folgeband wählte, einen, der weniger ähnlich geklungen hätte. Jetzt sieht das Ganze nach Masche aus.
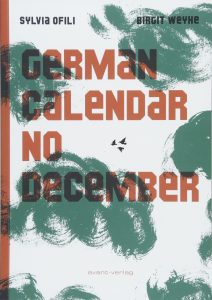
Und das ist das dritte und wichtigste Problem dieses Comics: Wieder wird eine afrikanisch-deutsche Migrationsgeschichte geboten. Sie ist nur leider ungleich weniger brisant als die von „Mad Germanes“. Zudem fragt man sich, was die ersten mehr als hundert Seiten (und damit mehr als die Hälfte des Buches) mit Olivias Internatsgeschichte sollen. Selbstverständlich ist es interessant, etwas über die bösartigen Machtspielchen unter Schülerinnen in einem nigerianischen Mädcheninternat zu lesen, aber bis Olivia dort ankommt, wird eine Spannung aufgebaut, die in einer Sequenz über das sorgsame Packen ihres Koffers mit der Schulausrüstung kulminiert, zu dem die Ich-Erzählerin sagt: „Da wussten wir noch nicht, dass am Ende des ersten Jahres alles gestohlen, zerstört oder verloren sein würde.“
Wer sich auch nur ein bisschen mit jüngerer nigerianischer Geschichte auskennt, befürchtet hier das Schlimmste. Schön für Olivia, dass es nicht eintritt, aber der dramatisch formulierte Satz ist ein Etikettenschwindel, denn außer fieser Schikane erleidet das junge Mädchen im Internat nichts. Dass dort überhaupt etwas gestohlen, zerstört oder verloren wird, wird später nie mehr angesprochen, die ganze Internatshandlung spult sich ab wie eine Seifenoper: vom Mauerblümchen zur Schülersprecherin. Das ist keine Erzählkunst, das ist belanglos, ein veritabler „Schulmädchenreport“, der zwar keinen Sex bietet, aber die schlichte Erzählweise des so betitelten Machwerks.
Mit dem Wechsel nach Deutschland wird die Geschichte immerhin insofern größer, als dass Olivia sich Geld als Verkäuferin am Hamburger Hauptbahnhof verdient und dabei in einen Freundeskreis von anderen Migranten aufgenommen wird, der in den Toiletten des Bahnhofs illegalen Asylbewerbern Unterschlupf gewährt. Was einen interessanten Zwiespalt zwischen individueller Moral und objektivem Gesetz hätte bilden können, wird aber zur bloßen Anekdotenabfolge, die ihren Tiefpunkt in einem peniblen deutschen Vorgesetzten findet, der die ganze Sache auffliegen lassen will, sich dann aber durch einen unglückliche Zufall ein Bein bricht und somit kein Problem mehr darstellt – als könnte ein solcher Mensch nicht auch noch vom Krankenbett aus Schwierigkeiten bereiten. Die Charakterzeichnung der Figuren ist – man muss es selbst in diesem afrikanisch-deutschen Kontext sagen (Olivia hat eine deutsche Mutter und einen nigerianischen Vater) – schwarzweiß.
Birgit Weyhes Comiczeichnungen bringen wenigstens Farbe hinein, aber mehr als ein Nebenwerk ihres Schaffens kann man in „German Calendar No December“ beim besten Willen nicht sehen. Schöne Bildmetaphern, ja, auch kluge Erzählsequenzen, die bewusst mit Statik arbeiten, auch dann, wenn es dramatisch wird – aber das alles kennen wir schon aus Weyhes eigenen Geschichten der Vergangenheit, die einfach besser geschrieben sind. Man fragt sich, wer oder was die beiden Autorinnen zusammengebracht hat. Ablesen kann man es dem Ergebnis leider nicht.