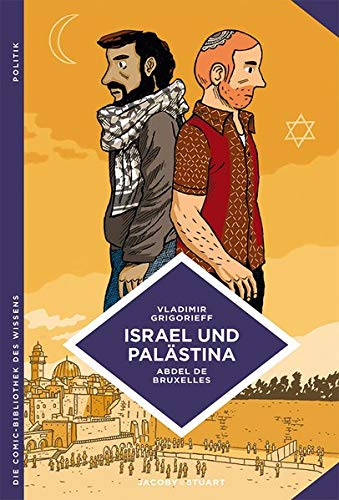James Sturm kehrt fast zehn Jahre nach „Markttag“ mit einem erstaunlichen Comic zurück: „Off Season“ erzählt vom privaten Desaster einer amerikanischen Ehe im Zeichen der Präsidentschaft von Donald Trump.
Die Bedeutung des 1965 geborenen Comiczeichner James Sturm für sein Metier kann man gar nicht überschätzen. Nicht nur, weil er mit „The Golem’s Mighty Swing“ und „Market Day“ (auf Deutsch bei Reprodukt als „Markttag“ erschienen) zwei großartige Comics über amerikanisch-jüdische Geschichte gezeichnet hat, sondern mehr noch, weil Sturm 2004 das Center für Cartoon Studies in der abgelegenen Kleinstadt White River Junction in Vermont gegründet hat. Wer jemals dort war, der weiß, wie engagiert dort die Kunst des Comiczeichnens vermittelt wird. Und mit Tillie Walden hat man mittlerweile auch eine hochberühmte Absolventin.
Aber Sturms Lehr- und Organisationstätigkeit schien auf Kosten seines Comiczeichnens zu gehen; jedenfalls ist „Market Day“ mittlerweile schon neun Jahre her. Umso überraschender erfolgte nun vor wenigen Wochen die Publikation eines Comics, mit dem Sturm gleich mehrfach Neuland betritt: „Off Season“ (Nebensaison), publiziert vom anspruchsvollsten nordamerikanischen Comicverlag, Drawn & Quarterly aus Kanada, erzählt keine historische und auch keine jüdische Geschichte. Anders als in den an klassischen amerikanischen comic books orientierten Vorläufern kommt hier zudem ein Querformat zum Einsatz, bei dem jede Seite zwei gleichgroße Panels bietet – denkbar strenge Formgebung also (eine kleine Leseprobe findet sich hier). Und statt Menschen treten sprechende Tiere auf, aber Sturm selbst thematisiert diese Maskenwahl mittels einer in die Handlung eingebauten Theaterszene: „as an actor it’s librating to wear the mask“, sagt einer der Akteure darin, und so soll man auch den Einsatz der Menschen aus „Off Season“ in ihren Tiergestalten verstehen. Die Darstellung als Hunde, wie es hier der Fall ist, verfremdet die Alltagsszenerie und lässt sie weniger individuell wirken.
Wobei die Geschichte von „Off Season“ zunächst einmal denkbar privat erscheint. Mark und Lisa, wohnhaft in einer ländlichen Kleinstadt der Vereinigten Staaten, haben sich nach sieben Jahren Ehe gerade getrennt, die Betreuung der beiden Kinder Suzie und Jeremy teilen sie sich. Ein Normalfall in westlichen Gesellschaften, aber für jedes betroffene Paar und allemal die Kinder doch ein Ausnahmezustand. Die übers Private hinausgehende Komponente der Geschichte ist ihr Handlungszeitraum: kurz vor bis kurz nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten im November 2016. Lisa und Mark unterstützten zunächst Bernie Sanders bei seiner Kandidatur als Bewerber der Demokraten; nach dessen Niederlage in den Vorwahlen gegen Hillary Clinton schwenkte Lisa jedoch ins Lager der Siegerin über, während Mark sie als Vertreterin des politischen Establishments verabscheut. Ob er dann bei der Präsidentschaftswahl Trump gewählt hat, erfahren wir nie, aber das ist nur eine der vielen von Sturm subtil offengelassenen Fragen in dieser Geschichte.
Die Panels enthalten meist einen Textkasten am oberen Rand, der Marks Sicht der Dinge mitteilt. Die muss nicht in Übereinstimmung mit der darunter gezeichneten Szene stehen, weder inhaltlich noch zeitlich. Diese Mischung aus geschriebenem inneren Monolog und gezeichneter objektiver Perspektive macht den Reiz des Bandes aus, auch sein Wagnis, denn die Gegenüberstellung lässt auch immer neue Zweifel an Marks Weltsicht zu – ein unzuverlässiger Erzähler im moralischen Verständnis. Gar nicht mal in dem Sinne, dass man seine politische Überzeugung anzweifelt, sondern im Hinblick darauf, ob seine Betrachtung und Bewältigungsversuche der familiären und beruflichen Probleme zutreffen.
Es ist herzzerreißend, wie die Spaltung der Familie sich immer weiter vertieft, und natürlich kommt man nicht umhin, diese Entwicklung als Parallele zur gesellschaftlichen Spaltung des gegenwärtigen Amerikas zu sehen. Wobei der Handlungsort eine nahezu homogene Kleinstadtbevölkerung erzwingt: Man darf in Sturms Wohnort in Vermont wohl das Vorbild für den nie dezidiert lokalisierten Schauplatz seines Comics sehen. Größere soziale Unterschiede oder gar Rassenkonflikte gibt es da gar nicht. Umso erschütternder ist der Zustand von Marks Familie und Freundeskreis.
Mit der Präzision, aber auch der Schärfe eines Skalpells präpariert Sturm die Allianzen um Mark und Lisa heraus, und so genau, wie er das Machtspiel innerhalb der Familie beobachtet – zwischen den Eltern und den Kindern –, hat man selten im Comic derartiges erzählt bekommen. Dazu kommt die lediglich grau lavierte Schwarzweiß-Stimmung und die jahreszeitlich bedingte (Herbst und Winter) Tristesse der Landschaft. Das alles macht visuell deutlich, als wie immer aussichtsloser Mark die eigene Situation erscheinen muss. Doch im letzten Kapitel – einem kompositionellen Meisterwerk, weil darin Erzähltext und dargestellte Szenen vollständig auseinanderfallen, aber sich allegorisch ergänzen – kommt eine kleine Hoffnung aus: James Sturm, der erkennbar am Zustand der Vereinigten Staaten leidet, gestattet sich keine ultimative Verzweiflung. Mir erscheint dieser versöhnende Schluss trotz anfänglichen Bedenken nach der zweiten Lektüre nunmehr als glaubhaft, weil auch er mehr Fragen offenlässt als beantwortet.
„Off Season“ ist eine intellektuelle Herausforderung: Nicht, weil dieser Comic schwer zu lesen wäre, sondern weil er als so einfach verständlich erscheint, aber die wichtigsten Themen des Lebens auf eine Weise behandelt, die nicht predigt, nicht belehrt, nicht einmal rät. Sondern einfach nur so genau hinsieht, wie man es von großer Erzählkunst erhofft. Dass man sich erst fragt, was diese hundegesichtigen Figuren eigentlich mit uns zu tun haben sollen, wenn die Rede im Comic auf die Tiermasken kommt, zeigt schon, wie souverän Sturm seine Geschichte erzählt; vorher ist ganz klar, dass sie zu uns gehören. Eigentlich hätte der Zeichner sich die metafiktionale Erörterung der Tierphysiognomien sparen können.