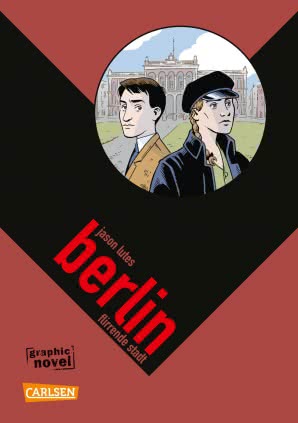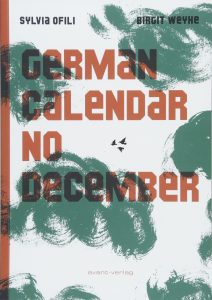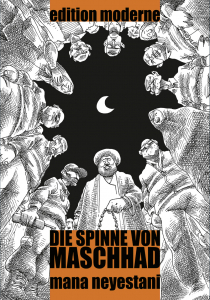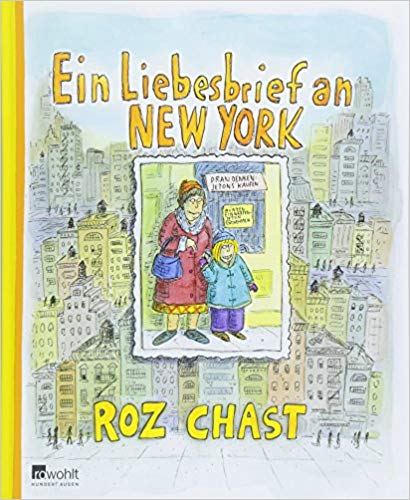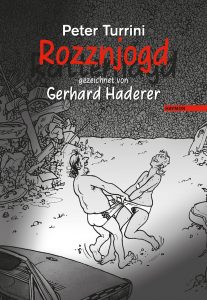Endlich ist es wieder soweit! Am 11. November 2018 steigt mit Pausen und Trompeten die große SONDERMANN-Geburtstags-Gala 2018. Auf der Gästeliste stehen u.a. Otto Waalkes, Fredi Bobic, Anna Haifisch sowie Rainer Michel & Cosmic Conjunction.
 Der „Sondermann 2018“ wird verliehen, der Oscar der Komischen Kunst! Aber an wen? Zuletzt freuten sich Jan Böhmermann, Hans Traxler oder Kathrin „Coldmirror“ Fricke über Ruhm, Ehre und Kohle, die der Sondermannverein zur Förderung und Verbreitung der Komischen Kunst jedes Jahr vergibt. Die Preisverleihung mit Scheck und Statue ist Teil einer gigantischen Geburtstagsgala, denn Otto wird in diesem Jahr 70 und Sondermann-Erfinder Bernd Pfarr wäre an diesem Abend 60 geworden. Das bedeutet: Torte für alle, sogar für die Preisträger Anna Haifisch und Otto Waalkes, für Eintracht-Vorstand Fredi Bobic, für Bandleader Rainer Michel mit seiner groovigen Cosmic Conjunction, für den Moderator Oliver Maria Schmitt, für Bernd Eilert, Hans Zippert u. v. a. m.
Der „Sondermann 2018“ wird verliehen, der Oscar der Komischen Kunst! Aber an wen? Zuletzt freuten sich Jan Böhmermann, Hans Traxler oder Kathrin „Coldmirror“ Fricke über Ruhm, Ehre und Kohle, die der Sondermannverein zur Förderung und Verbreitung der Komischen Kunst jedes Jahr vergibt. Die Preisverleihung mit Scheck und Statue ist Teil einer gigantischen Geburtstagsgala, denn Otto wird in diesem Jahr 70 und Sondermann-Erfinder Bernd Pfarr wäre an diesem Abend 60 geworden. Das bedeutet: Torte für alle, sogar für die Preisträger Anna Haifisch und Otto Waalkes, für Eintracht-Vorstand Fredi Bobic, für Bandleader Rainer Michel mit seiner groovigen Cosmic Conjunction, für den Moderator Oliver Maria Schmitt, für Bernd Eilert, Hans Zippert u. v. a. m.
Die Veranstaltung ist lactosefrei, kann aber Spuren von Erdnüssen enthalten! Essen Kommen Sie reichlich!
Und zwar in die BROTFABRIK FRANKFURT, Bachmannstr. 2 – 4, 60488 Frankfurt am Main, Einlass: 19.00 Uhr
Tickets gibt es hier!