 Der TITANIC-Redakteur und Journalist Fabian Lichter war 2016 Stipendiat des Sondermann e.V. – heute widmet er uns diesen Text.
Der TITANIC-Redakteur und Journalist Fabian Lichter war 2016 Stipendiat des Sondermann e.V. – heute widmet er uns diesen Text.
Endstation Frankfurt
Ich stehe vor dem Bahnschalter und möchte gerne lösen. „Ui, des isch aber ganz schön weit, junger Mann“, warnt mich die Mitarbeiterin im Bahnhof meiner Geburtsstadt Singen am Hohentwiel, als ich – zum Zeitpunkt zarte 28 Jahre alt – alleine ein Ticket nach Frankfurt am Main erstehen möchte. Wir sorgen uns beide ein wenig. Sie sich um mich und ich mich sowieso um mich.
Hartes Pflaster Frankfurt. Während die Fahrkarte aus dem Drucker gekrochen kommt, blicke ich die Frau an und meine genau zu wissen, was sie in diesem Moment denkt: „Warum fährt der Kerle jetzt ausgrechnet nach Frankfurt? Auch noch zum Hauptbahnhof. Dabei haben mir hier so schöne Städtle zum anfahre bei uns im Landkreis und Umgebung: Orsingen-Nenzingen, Sipplingen, Gailingen, Dettingen, Orwingen, Frickingen, Kreuzlingen, Worblingen, Hilzingen, Steißlingen, Eigeltingen, Bermatingen – und der Seckel will ausgrechnet nach Frankfurt!“
Doch meine Geschichte ist zu kompliziert, um sie ihr jetzt und hier mal eben schnell erzählen zu können, also antworte ich mit einem knappen: „Ja, stimmt!“ Ich muss ja zur Titanic, nach Bockenheim. Nach Wald-und Wiesenschuljahren in den tiefsten Winkeln süddeutscher Provinznester, Jahren in Freiburg im Breisgau und zeitweise auch mal dem nordhessischen Kassel, einem Leben auf dem zweiten, dritten, vierten – jedenfalls einigen Bildungs- und Studienwegen, geht es nun in die verhältnismäßig große Stadt. Frankfurt! Hier haben schon Geistesgiganten wie Theodor W. Adorno, Eckhard Henscheid und Volker Bouffier Unglaubliches vollbracht. Sternchen wie Johann Wolfgang von Goethe und Sonya Kraus haben ihre Wurzeln in der Hessenmetropole. Was bringt mir die Zukunft? Kann ich auch nur ein bißchen so sein wie sie?
Andere sind hier gnadenlos abgeschmiert, zerbrochen. Weil sie zu naiv waren, zu träumerisch vielleicht, den Verlockungen des urbanen Lebens nicht widerstehen konnten, siehe Michel Friedman. Entsprechend aufgeregt stehe ich nun da. Das mögliche Scheitern, die Gefahren der Großstadt, alles im Hinterkopf. Das gefährlichste, das einem im heimischen Baden-Württemberg passieren kann, sind im Grunde nur die bisweilen leicht erhöhten Kalkwerte im Leitungswasser, Regenwetter oder Schnecken im Garten. Auch kein Pappenstiel, keine Frage. Aber in Frankfurt geht es richtig ab, das weiß ich. In Frankfurt, so stelle ich es mir vor, da fliehen die Schnecken freiwillig aufs Land.
Das also waren meine Gedanken, als ich einst nach Frankfurt fuhr, die ersten Tage liegen inzwischen längst wieder weit hinter mir, Ängste und Sorgen haben sich gelegt, man ist angekommen. Zwar habe ich bis dato weder ein philosophisches Hauptwerk hingelegt, noch ein Kokainproblem entwickelt, dennoch habe ich den Ticketkauf am Singener Bahnhof nicht bereut. Und Orsingen-Nenzingen habe ich bis heute nie gesehen!

 Die TITANIC-Redakteurin und Romanautorin Ella Carina Werner war 2015 Stipendiatin des Sondermann e.V., dem sie den folgenden Text widmete.
Die TITANIC-Redakteurin und Romanautorin Ella Carina Werner war 2015 Stipendiatin des Sondermann e.V., dem sie den folgenden Text widmete. Es ist soweit: Die Sondermann-Preisträger des Jahres 2017 stehen fest! Noch müssen wir die Gewinner geheimhalten; dafür verrät Ihnen der Sondermann e.V., welche Kandidaten den Preis garantiert nicht gewonnen haben – in eigenhändigen Stellungnahmen der Verlierer.
Es ist soweit: Die Sondermann-Preisträger des Jahres 2017 stehen fest! Noch müssen wir die Gewinner geheimhalten; dafür verrät Ihnen der Sondermann e.V., welche Kandidaten den Preis garantiert nicht gewonnen haben – in eigenhändigen Stellungnahmen der Verlierer.
 Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme
Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme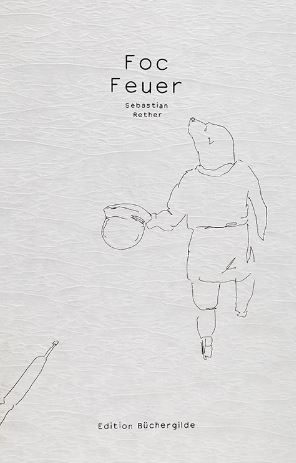 Abstrakter Krieg erschreckt genauso
Abstrakter Krieg erschreckt genauso Dortmund im Schatten des Hakenkreuzes
Dortmund im Schatten des Hakenkreuzes Schöner kann es am Meer selbst nicht sein
Schöner kann es am Meer selbst nicht sein