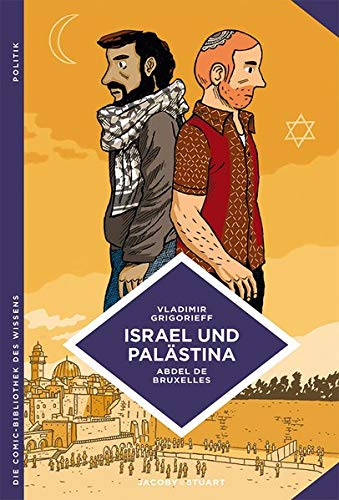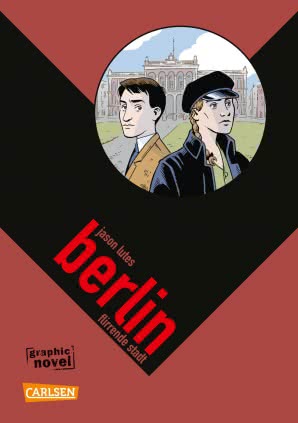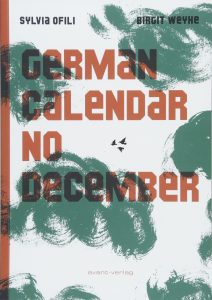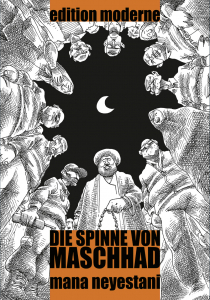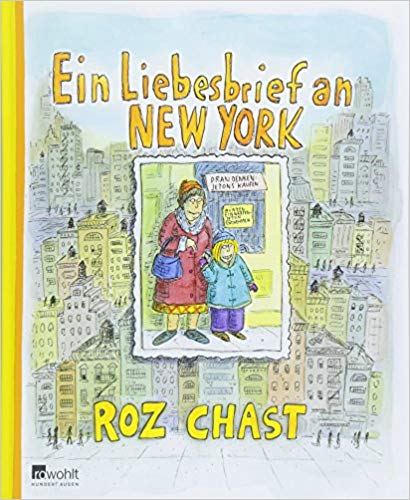Mittlerweile hat sich auch in der Presse herumgesprochen, wer der diesjährige Sondermann-Preisträger ist, wer den Förderpreis einsacken wird, wer als Laudator die Bühne betritt und wer wieder nur am Büffet herumstehen wird.
Wer sich dieses kulturhistorische Ereignis nicht entgehen lassen will, kommt am 11.11.2018 um 20.00 Uhr in die Brotfabrik Frankfurt (Bachmannstraße 2-4, 60488 Frankfurt am Main), ordert vorher aber hier noch eine Eintrittskarte.
Der Sondermann e.V. freut sich auf Sie, Sie, Sie und ganz besonders Sie!