 Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.
Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.
Jetzt Mitglied werden und alles Jahresgaben einsacken!

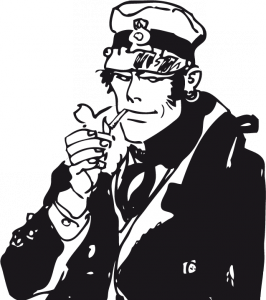 Die Lücke im Cortoversum
Die Lücke im Cortoversum Fakten vs. Pathos
Fakten vs. Pathos Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat
Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat
 Immer wieder diese kriegerischen Nachbarn!
Immer wieder diese kriegerischen Nachbarn! Schon sehr früh im Jahr steht er fest: der Sondermann-Stipendiat 2016! In jährlicher Folge unterstützt der Verein einen jungen Autor oder Zeichner aus dem Bereich der Komischen Kunst bei einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Frankfurt und ermöglicht ihm Praktika in verschiedenen Medienhäusern (TITANIC, Caricatura, FAZ, FR) – unabhängig von den Regularien des Sondermann-Preises.
Schon sehr früh im Jahr steht er fest: der Sondermann-Stipendiat 2016! In jährlicher Folge unterstützt der Verein einen jungen Autor oder Zeichner aus dem Bereich der Komischen Kunst bei einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Frankfurt und ermöglicht ihm Praktika in verschiedenen Medienhäusern (TITANIC, Caricatura, FAZ, FR) – unabhängig von den Regularien des Sondermann-Preises. Nur noch wenige Wochen, dann wird der nächste Sondermann-Preis für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der komischen Kunst vergeben.
Nur noch wenige Wochen, dann wird der nächste Sondermann-Preis für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der komischen Kunst vergeben. Schock nach dem Schlusspfiff
Schock nach dem Schlusspfiff von Andreas Platthaus
von Andreas Platthaus